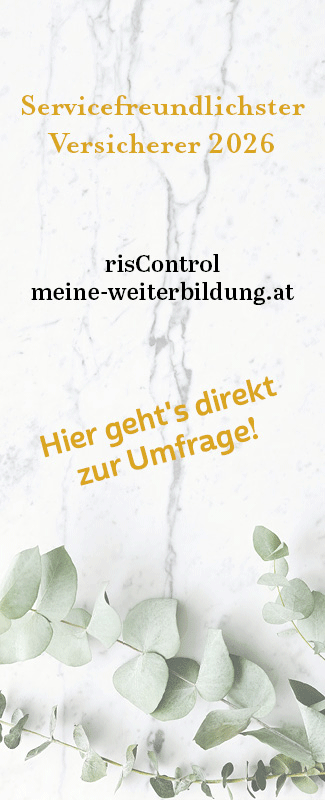US-Präsident Donald Trump setzte gleich zu Beginn seiner Amtszeit Mexiko und Kanada mit Zöllen unter Druck und teilte mit protektionistischen Ankündigungen in alle Richtungen aus. Am 2. April erreichten Trumps protektionistische Maßnahmen ihren bisherigen Höhepunkt – den sogenannten „Liberation Day“. An diesem Tag verhängte Trump neben einer Grundabgabe von zehn Prozent auf Importe auch zusätzliche reziproke Zölle zwischen zehn und 49 Prozent gegenüber bedeutenden Handelspartnern. Für Autoimporte gibt es einen Zollsatz von 25 Prozent. Laut Analysten steigt dadurch der effektive US-Zollsatz von aktuell 6,6 Prozent auf über 20 Prozent, den höchsten Stand seit rund 100 Jahren.
Die Struktur der neuen „reziproken Zölle“ orientiert sich an der Handelsbilanz der USA. Es werden Zollsätze berechnet, die erforderlich wären, um bilaterale Handelsdefizite auf Null zu reduzieren – so in der offiziellen Mitteilung des Executive Office Of The President. Konkret berechnet sich der Zollsatz unter Weglassung der Faktoren für Preiselastizität der Importnachfrage und dem Durchschlagsfaktor der Zölle auf die Importpreise anhand folgender einfacher Formel:
Zollsatz = (Handelsdefizit / Importe) × 100
Beispiel China: Bei einem Handelsdefizit von 291,9 Milliarden US-Dollar und Importen von 433,8 Milliarden US-Dollar ergäbe dies rechnerisch einen Zollsatz von etwa 67 Prozent. Davon setzt Trump „gnädigerweise nur“ die Hälfte, also etwa 34 Prozent, um. Auf China-Importe fallen bereits 20 Prozent fix an, womit sich diese dann auf 54 Prozent verteuern. Allerdings stößt diese Berechnungsmethode auf breite Kritik. Die Experten der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch etwa bezeichnen die Berechnungslogik als „völlig absurd“ und losgelöst von der tatsächlichen Zollrealität.
Drohendes Stagflations-Szenario
Experten wie Paul Diggle, Chefvolkswirt bei Aberdeen, warnen vor weiteren Eskalationen: „Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die Ankündigungen der vergangenen Tage – so drastisch sie auch waren – nicht das ‚Höchstmaß‘ der Zölle darstellen. Wir gehen weiterhin davon aus, dass zusätzliche sektorbezogene Zölle folgen werden, insbesondere auf Halbleiter, Kupfer, Bauholz und pharmazeutische Produkte.“ Zudem könnte Trump die Zölle jederzeit erhöhen, falls Handelspartner Gegenmaßnahmen ergreifen.
Die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen sind erheblich: Laut Diggle erhöht gemäß einer groben Faustregel jeder Prozentpunkt Anstieg im gewichteten US-Zollsatz das allgemeine Preisniveau um 0,1 Prozentpunkte und senkt das BIP um 0,05 bis 0,1 Prozentpunkte. Hochgerechnet könnten die jüngsten Zollerhöhungen somit die US-Verbraucherpreise um bis zu zwei Prozent steigen lassen und das BIP um ein bis zwei Prozent reduzieren. Dies würde eine Rezession wahrscheinlicher machen.
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) simulierte zudem, dass alleine in Deutschland über die vierjährige Amtszeit Trumps ein Schaden von rund 200 Milliarden Euro entstehen könnte. Für die EU insgesamt läge der geschätzte Schaden sogar bei etwa 750 Milliarden Euro, was einen BIP-Rückgang um 1,5 Prozent bis 2028 bedeutet.
Zwei Szenarien sind denkbar: Viele Marktteilnehmer hoffen, dass Trump mit den drastischen Zollankündigungen lediglich Druck auf Handelspartner ausübt, um bessere Handelsabkommen auszuhandeln. In diesem optimistischeren Szenario wären nur minimale Inflationserhöhungen und eine leichte konjunkturelle Abkühlung zu erwarten. Doch das alternative Szenario einer dauerhaften Verschärfung der Zollpolitik birgt das Risiko einer Stagflation, also wirtschaftlicher Stagnation bei gleichzeitig erhöhten Inflationsraten und in weiterer Folge einer globalen Rezession.