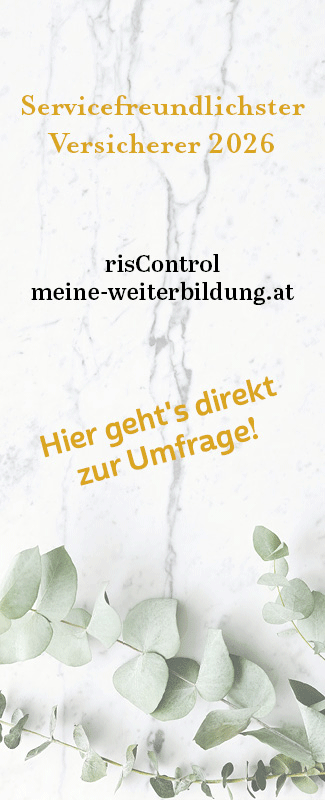Die jüngste Leitzinssenkung der US-Notenbank wirft Fragen auf. Ist sie rein ökonomisch begründet oder bereits Folge wachsender politischer Einflussnahme durch Präsident Trump? Welche Motive könnten dahinterstecken?
Die Argumentation der Fed, im Zuge der jüngsten Leitzinssenkung um 25 Basispunkte auf 4,00 bis 4,25 % gibt Anlass zur Diskussion, ob nicht doch schon ein politischer Druckfaktor seitens US-Präsident Donald Trump im Spiel ist, der sich für niedrigere Leitzinsen ausspricht und dies auch durchsetzen möchte. Obwohl die Inflationsrisiken und Unsicherheiten zuletzt zunahmen, war ein sich abschwächender Arbeitsmarkt der Auslöser für den Zinsschritt. Dabei ist die Arbeitslosenquote im August lediglich von 4,2 auf 4,3 % gestiegen, während die Anzahl der neu geschaffenen Stellen mit 22.000 unter den Erwartungen der Analysten lag. Letzterer Punkt spricht durchaus dafür, dass ein kleiner Zinsschritt sachlich gerechtfertigt ist, damit es nicht zu einer vom Arbeitsmarkt ausgehenden zusätzlichen Abschwächung kommt.
Aber es gibt auch kritischere Stimmen dazu, wie jene von Marc Möhrle, Geschäftsführer bei der LAIQON-Tochter MFI Asset Management. Für ihn erweckt es den Eindruck, „dass die Leitzinssenkung am 17.09. politisch motiviert war“. „Die wirtschaftliche Ausgangslage hat sich in den USA in den vergangenen Wochen und Monaten nicht maßgeblich verändert. Das Wachstum hat im zweiten Quartal sogar nach oben überrascht. Zusätzlich zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust, wenn auch in den vergangenen Wochen die Revisionen der US-Beschäftigungszahlen von den Marktteilnehmern ausgiebig diskutiert und als rational für potenzielle Zinssenkungen herangezogen wurden“.
Ein Versuch, die Kosten der Staatsfinanzierung zu senken?
Möhrle sieht ein anderes Motiv hinter der Leitzinssenkung: „Unserer Meinung nach gibt es nur eine Rationalisierung des Zinsschritts. Bis Ende 2025 werden US-Staatsanleihen in einer Höhe von ca. 6 Billionen (!) US-Dollar fällig und müssen refinanziert werden, zusätzlich zu der anstehenden Finanzierung des „One Big Beautiful Bill“. Dementsprechend entlastet jede Zinssenkung die Zinslast und damit einhergehend das US-Fiskalbudget deutlich. Des Weiteren ist in den vergangenen Jahren die Nachfrage der ausländischen Investoren nach US-Staatsanleihen deutlich zurückgegangen und ausländische Zentralbanken haben die Bestände in US-Staatsanleihen zu zugunsten von Goldreserven abgebaut – allen voran China aber auch Japan. Durch die potenziellen Zinssenkungen könnte auch beabsichtigt sein, die Nachfrage zu stützen und Investitionen in US-Staatsanleihen zu intensivieren“.
Salopp formuliert sieht es also nach einer Förderaktion für US-Treasuries aus. Um zu einer neuen Ära niedriger Zinsen zu gelangen, zieht die US-Regierung ihre Fäden. Dazu Möhrle: „In den USA ist generell eine große Einflussnahme der US-Regierung in verschiedenen Bereichen zu beobachten (bspw. Fall Jimmy Kimmel). Man konnte bei der Sitzung der Federal Reserve im September gut beobachten, dass die Manipulationsversuche durch die US-Regierung zunehmen. Das neue, von Präsident Trump berufene Vorstandsmitglied der US-Notenbank, Stephen Miran, hat sich als einziger Fed-Gouverneur für eine stärkere Zinssenkung von 0,5 Prozentpunkten ausgesprochen“. Fed Chairman Jerome Powell bleibt in dieser Funktion nur noch bis 15. Mai 2026 und dann wird es spannend. „Das Federal Open Market Committee (FOMC) besteht insgesamt aus 12 stimmberechtigten Mitgliedern. Der Fed-Vorsitz hat im Falle von Stimmengleichheit die doppelte Stimme, jedoch sollte das gesamte Gremium betrachtet werden und nicht ausschließlich der Vorsitzende. Es ist aber natürlich bezeichnend, dass der Versuch unternommen wird, das Vorstandsmitglied mit der längsten verbleibenden Amtszeit (Lisa D. Cook gewählt bis 2038), abzusetzen. Dementsprechend ist ein denkbares Szenario, dass die Unabhängigkeit der Federal Reserve auf Jahre nicht mehr in Gänze gewährleistet werden kann und die Interessen der US-Regierung deutlich mehr Berücksichtigung finden. Zum aktuellen Zeitpunkt sind das weitere Zinssenkungen, um die Re-Finanzierungskosten zu senken und das Fiskalbudget zu entlasten. Inflationsgefahren würden dabei negiert oder als notwendiger Kollateralschaden der US-Politik akzeptiert“, kommentiert Möhrle
Das gab es schon einmal
Schon in den vergangenen Jahrzehnten versuchten US-Präsidenten mehr oder weniger Einfluss auf die Geldpolitik zu nehmen und so eine „Trump-Situation“ gab es bereits in den 70er-Jahren. US-Präsident Richard Nixon war hier extrem, indem er mit der Fed 160-Mal interagierte. Von Januar 1969 bis Juli 1974 stieg dann die Inflationsrate von 4,4 auf 11,5 %. Dass es hier wirkliche Zusammenhänge gibt zeigt eine Studie von Thomas Drechsel, Assistant Professor an der University of Maryland im Mai 2024 mit dem Titel „Estimating the Effects of Political Pressure on the Fed: A Narrative Approach with New Data”. Sie wertete detaillierte Tagespläne der US-Präsidenten in den Jahren 1933 bis 2016 aus und erfasste insgesamt über 800 persönliche Interaktionen zwischen Präsidenten und Fed-Vertretern (92 % mit dem Fed-Chairman). Das Ergebnis: Starker politischer Druck schlägt sich dauerhaft in höheren Preisen nieder. Im Schnitt sinken die kurzfristigen Zinsen nach einigen Quartalen um etwa einen Prozentpunkt. Auf längere Sicht – nach rund vier Jahren – liegt das Preisniveau dadurch rund 5 % höher.