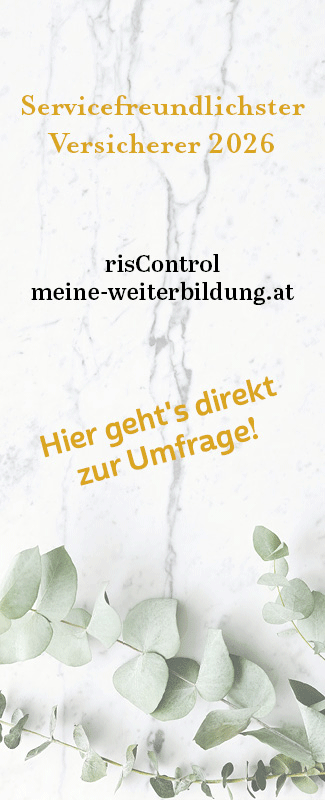Auf der diesjährigen Finanzmarktaufsichtskonferenz (FMA) in Wien diskutierten wieder hochrangige Vertreter europäischer Institutionen und der Finanzwirtschaft aktuelle Entwicklungen im Bankensektor. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der „Schwarzen Schwäne“ in der Finanzwelt nicht weniger wird.
„Es gibt nicht nur einen Schwarzen Schwan“, erklärte Dominique Laboureix, Vorsitzender des Single Resolution Board (SRB). „Schwarze Schwäne“ sind seltene, schwer vorhersehbare Ereignisse mit potenziell weitreichender Wirkung. Für Laboureix zeigt das Beispiel der Credit Suisse eine zentrale Lektion: Die Geschwindigkeit einer Krise wird heute maßgeblich von Social Media befeuert. Hinzu kommen operative Risiken durch Cyberattacken, die etwa Daten manipulieren können – daraus ergeben sich Reputationsrisiken, die sich zu einem perfekten Schwarzen Schwan verdichten können. Die Kombination aus Cyberangriffen, schnell verbreiteten Informationen und Reputationsverlusten stellt für Laboureix eine Art „perfekten Sturm“ dar. Auch Peter Bosek, CEO der Erste Group, bestätigt: „Die Auswirkungen der sozialen Medien und Cyberattacken von Staaten können toxisch sein.“ Technologische Innovationen und digitale Zahlungsmittel können selbst potenzielle systemische Risiken darstellen. Für Rebecca Christie ist es vor allem der digitale Euro, der – wenn er in der Schublade bleibt – zu einem großen Risiko werden könnte. Wenn die EZB keinen digitalen Euro einführt, werde das der Privatsektor tun. Im Worst-Case-Szenario könne das den Euro unterminieren, erklärt Christie. „Das macht mir Angst.“
Vertrauen entscheidend
Laboureix betonte, dass Vertrauen ein zentraler Faktor für die Stabilität der Bankenunion ist: Nur wenn Sparer und Märkte auf die Institute und die gemeinsamen Regeln vertrauen, können Banken auch in Krisensituationen effektiv reagieren. Claudia Buch ergänzte, dass die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors nicht zuletzt durch die Bankenunion deutlich gestärkt wurde – sie verwies auf solide Kapitalquoten von durchschnittlich 16 % und auf einen Rückgang notleidender Kredite auf rund 2 %. Helmut Ettl, Vorstand der FMA, wies darauf hin, dass der österreichische Bankensektor in den letzten elf Jahren stark verändert wurde: „Wir haben alle Instrumente genutzt, die uns durch die Bankenunion zur Verfügung gestellt wurden. Banken, die nicht zukunftsfähig sind, müssen sich neu erfinden oder den Markt verlassen.“
Simplifizierung heißt nicht Deregulierung
Ein wichtiges Thema in den Diskussionen war auch die Simplifizierung der Regulierung. Buch wies darauf hin, dass Simplifizierung bei der EZB auf der Agenda steht – dies jedoch nicht mit Deregulierung gleichzusetzen sei. Es gehe um eine effizientere Gestaltung von Prozessen sowie um die Nutzung und den Austausch von Informationen mit anderen Behörden.
Der Ruf der Industrie nach Vereinfachung geht auch einher mit der Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Bankensystems. Rebecca Christie relativierte diese Sorge, als sie auf die Unterschiede zwischen Europa und den USA zu sprechen kam: Dort müssen Banken eine deutlich höhere Kapitalunterlegung aufweisen, insbesondere im Hinblick auf das Leverage-Ratio, während die europäische Bankenunion auf harmonisierte, aber insgesamt niedrigere Kapitalquoten setzt.