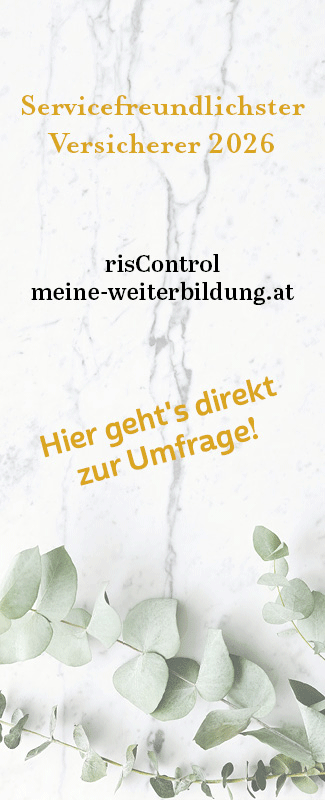Auf der Gewinn-Messe in Wien sprach der Generaldirektor der Wiener Städtischen, Dr.Ralph Müller, über die Probleme des Pensionssystems in Österreich.
Zu Beginn führte Müller aus, dass im Lebensversicherungsgeschäft eine Trendumkehr erkennbar sei. Die beinahe jahrzehntelange Flaute mit Prämienrückgängen in dieser Sparte scheine vorüber. „Das Geschäft mit der Altersvorsorge boomt wieder.“ Bereits 2023 habe man im Neugeschäft ein Plus von etwa 30 Prozent erzielt, und auch heuer gebe es einen Zuwachs von rund zehn Prozent. Gerade die Diskussion rund um die Kosten des Umlagesystems, den Staatshaushalt und die Konjunktursorgen befeuere das Geschäft in der privaten Vorsorge, so Müller.
Pensionen auf Pump
Es geschehe zu wenig im Bereich der Pensionsreform, kritisiert Müller. Man hätte die Weichen schon früher stellen müssen. „Es ist jetzt noch der Moment, etwas zu tun, aber eigentlich haben wir viele Jahre gewisse Themen nicht geregelt.“ Allein die Zuschüsse des Staates für Pensionen betragen rund 30 Milliarden Euro pro Jahr. Die Gesamthöhe in Kombination mit schwachem Wachstum und hoher Staatsverschuldung sei bedenklich, führt Müller aus. „Wenn wir heuer auf 4,5 Prozent zusätzliche Verschuldung, gerechnet am Bruttoinlandsprodukt, zusteuern, dann sind das etwa 20 Milliarden. Wir finanzieren einen guten Teil der Pensionen auf Kredit – was für die nächsten Generationen fatal ist.“ Verstärkt werde dies durch die steigende Lebenserwartung. „Man muss etwas tun, damit Menschen, die länger arbeiten können und wollen, auch die Möglichkeit dazu haben.“ Müller fordert daher eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters.
Kapitaldeckung fehlt
Ein kapitalgedeckter Staatsfonds fehle in Österreich, bedauert Müller. „Da sind wir im Vergleich zu Ländern wie den Niederlanden oder Skandinavien massiv im Hintertreffen.“ Er vergleicht die Lage Österreichs mit einer Reihenhaussiedlung, in der einige Bewohner einen Kredit für ihr Eigenheim aufgenommen haben, während andere seit vielen Jahren monatlich 300 Euro in einen ETF einzahlen. „Mit diesen Nachbarn können wir nicht konkurrieren.“ Es sei höchste Zeit, das Ruder herumzureißen. In Norwegen fließe ein Großteil der Einnahmen aus Erdöl und Erdgas in einen Staatsfonds. Dieser habe mittlerweile ein Volumen von 1,7 Billionen Euro und im letzten Jahr einen Mehrzuwachs von 200 Milliarden Euro erzielt. „So könnten wir die Pensionen mehrfach bezahlen“, so Müller. Andere Länder machten sich mittlerweile ebenfalls auf den Weg in Richtung einer kapitalgedeckten ersten Säule. Als Beispiel nennt Müller Polen, das nun auch mit Kapitalaufbau beginne. Er schlägt vor, in den nächsten 24 Monaten die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen und dann die Weichen für Sanierungen in der ersten Säule zu stellen.
Pensionskassen zu Unrecht kritisiert
Das Gesamtkapital in der zweiten und dritten Säule beläuft sich derzeit auf weniger als 100 Milliarden Euro und liegt damit deutlich unter zehn Prozent im Verhältnis zu den Leistungen aus der ersten Säule. „Das ist kein sehr gesundes Verhältnis.“ Die Pensionskassen seien nach Meinung von Müller dennoch zu Unrecht in Verruf geraten. Man habe die Modelle in den 1990er-Jahren mit einem Rechenzins von sieben Prozent kalkuliert. Durch die Nullzinspolitik der EZB seien daher Kürzungen der ursprünglich in Aussicht gestellten Pensionen erfolgt. „Aber seit 20 Jahren hat man das Thema dort besser im Griff.“ In der Lebensversicherung plädiert Müller in der Vorsorge für Modelle mit Aktienanteilen. Die klassische Variante sei zwar sehr sicher, aber auf lange Sicht mit einem Wertverlust verbunden.