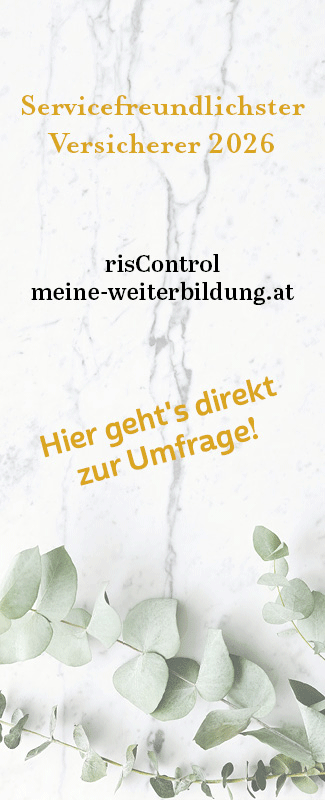Die Märkte, wie wir sie kannten, haben sich tiefgreifend verändert. Einst war die Börse ein Mosaik aus vielen kleinen und mittleren Unternehmen: regionale Champions, Familienbetriebe, Nischenanbieter, die mit Innovationskraft und Wachstum überraschten. IPOs markierten oft den Start eines längeren, profitablen Aufstiegs — der „Neue Markt“ der späten 90er-Jahre ist dafür ein gutes Beispiel. Heute dominiert eine andere Mechanik: Kapitalstrom, Skalenvorteile, disruptive Technologien, die teils Quasi-Monopole schaffen und die heutigen Finanzierungspraktiken haben eine Handvoll globaler Giganten an die Spitze gespült. Diese MegaCaps (Techplattformen, globale Industriekonzerne, große Versorger) wirken universell: egal ob ESG, KI, Digitalisierung oder Infrastruktur — ihr Name fällt fast automatisch in Bezug auf zahlreiche Anlagethemen. Es sind Riesen wie NVIDIA, Microsoft, Broadcom, Alphabet, Amazon, Apple, AMD, NextEra Energy oder in Europa Schneider Electric. Geht es um spezifischere Themen wie Cybersecurity ist Palantir mit einer Marktkapitalisierung von ca. 425 Mrd. USD im Spiel, während NVIDIA es sogar auf einen Börsenwert von 4,37 Bio. USD bringt. Das entspricht annähernd dem deutschen BIP im Jahr 2024. Meta als Schöpfer einer großangelegten virtuellen Realität weist eine Börsenkapitalisierung von 1,8 Bio. USD auf.
Mehrere Faktoren erklären diese Entwicklung: Netzwerkeffekte und Datenmonopole erzeugen dauerhafte Wettbewerbsvorteile. Venture Capital pumpt früh riesige Summen in Startups, sodass viele junge Firmen vor einem IPO bereits hoch kapitalisiert und optimiert sind. Die klassische IPO-Phase als Hauptgeldquelle ist indessen seltener geworden. Private-Equity-Deals und strategische Übernahmen saugen leistungsfähige Mittelständler auf. Die Vielfalt lukrativer Unternehmen am Aktienmarkt schwindet. Und nicht zuletzt verstärkt passive Allokation über ETFs die Schieflage: Indexgeld fließt gewichtet in die größten Positionen, treibt Bewertungen und reduziert den Preisbildungsdruck, den ein vielfältiger, aktiver Markt früher erzeugte.
Für Anleger hat das mehrere Auswirkungen. Erstens ein Konzentrationsrisiko: Der Markt wird anfälliger für wenige systemrelevante Akteure. Zweitens: Bewertungsdruck auf die verbleibenden Small- und MidCaps: Viele „Wunderstories“ sind seltener, da Wachstumskapital und Exit-Mechanismen anders funktionieren und Analysten und Fonds sich zunehmend auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung konzentrieren. Drittens: Kapitalzuflüsse in ETFs fördern Momentum und Verfestigung der Größten; gleichzeitig schwindet die Breite aktiver Manager, die früher Chancen jenseits des Mainstreams entdeckten.
Aktienselektion neu
Heißt das: Stockpicking ist tot? Keineswegs — es braucht nur eine veränderte Herangehensweise. Stockpicking verlagert sich weg vom universellen, breiten Jagen nach dem nächsten Tech-Phänomen (wie AI, Cloud, Cybersecurity….), hin zu fokussierten Nischen, regionalen Besonderheiten und fundamentgetriebenen Value-Geschichten. Praktische Handlungsimpulse:
- Spielfeld wechseln: Small- und MidCaps existieren weiterhin — oft in lokalen Märkten und speziellen Wertschöpfungsketten (Infrastruktur-Zulieferer, spezialisierte Maschinenbauer, Tower- und Versorgungsdienstleister). Wer bereit ist, regional zu recherchieren, findet Unternehmen, die von strukturellen Megathemen profitieren, ohne bereits Teil eines globalen Monopols zu sein.
- Fokus auf reale Nachfrage: Infrastruktur, Versorgung, spezialisierte Industrieanlagen, Wasserwirtschaft, lokale Bauwirtschaft — das sind Bereiche mit klarer, physischer Nachfrage, öffentlichen Auftraggebern und Backlogs. Solche Geschäftsmodelle sind planbarer als reine Hype-Playbooks.
- Geographische Diversifikation nützen: Korea, Teile Osteuropas, Lateinamerika und selektive Schwellenländer bieten noch Nischenchampions und Bewertungslücken. Hier zahlt sich lokales Know-how aus — Sprache, regulatorisches Verständnis, Zugang zu Research.
- Think deep, not wide: Erfolgreiches Stockpicking wird wieder zur Expertenarbeit. Quartalsberichte, Auftragsbücher, Kundenkonzentration, lokale Medien, Meinungen von Kunden und Lieferanten – daraus generierte Infos schaffen Mehrwert gegenüber passiven Algorithmen.
- Profitieren von struktureller Rotation: Marktphasen wechseln. Regulatorische Gegenmaßnahmen (Antitrust), Zinsveränderungen oder eine Schwäche in den Top-Segmenten können Ratingänderungen der Analysten auslösen. Positionen in unterbewerteten Sektoren hingegen bieten asymmetrische Chancen, wenn man Disziplin und Geduld hat.
- Operative Regeln beibehalten: klare Sizing-Regeln, Stop/Trim-Mechanismen, Catalyst-Maps und ein striktes Research-Playbook sind jetzt wichtiger denn je. Disziplin ersetzt Glück.
Kurz gesagt: Der Kapitalmarkt ist nicht tot. Er hat seine Regeln geändert. Die Ära der „einfachen Wunder“ mag seltener sein, aber wer bereit ist, das Feld neu zu betreten — lokal, tief, thematisch — findet weiterhin echte Investmentmöglichkeiten. Stockpicking bleibt möglich, es ist nur wieder anspruchsvoller, spezialisierter und belohnt diejenigen, die echte Forschung betreiben statt dem Sog der Megacaps blind zu folgen.