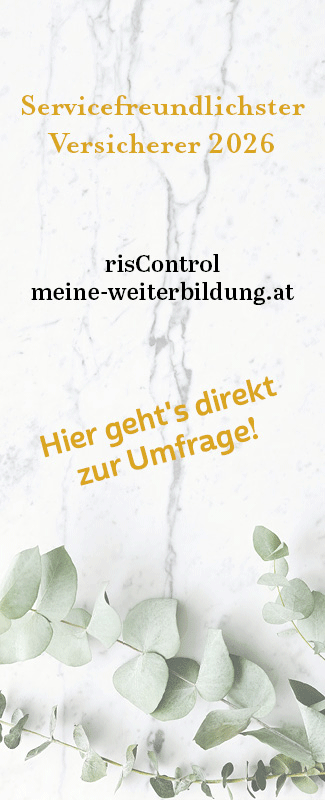Die neue Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, Shoura Zehetner-Hashemi, spricht im risControl-Interview unter anderem über den Krieg im Gazastreifen, die Situation in Iran und die Luxusprobleme in Österreich.
Was waren ihre Schwerpunkte, seitdem sie 2023 Amnesty-Chefin in Österreich geworden sind?
Wir wollten das Jahr nutzen, um Lobbying für Menschenrechtsthemen zu machen. Aber dann kam der 7. Oktober, der Tag des Hamas-Angriffs. Und seitdem ist die Arbeit sehr stark verlagert auf militärische Konflikte, humanitäres Völkerrecht, Kriegsverbrechen und den Schutz von Zivilisten. Das war sehr schwierig im österreichischen Kontext.
Warum war das schwierig? Wegen der Positionierung Pro- und Contra- Israel?
Wir solidarisieren uns mit den Opfern von Menschenrechtsverletzungen, egal von wo, egal welcher Gesinnung. Aber genau das war im österreichischen Kontext sehr schwierig, weil eigentlich erwartet wurde, dass man sich ganz klar mit Israel solidarisiert. Als Menschenrechtsorganisation müssen wir da völlig überparteilich bleiben.
Was macht ihr konkret in diesem Konflikt?
Wir sind keine Hilfsorganisation, also wir entsenden keine Teams und helfen vor Ort. Was wir machen, ist, Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Wir haben Researcher sowohl in Israel als auch im Gazastreifen und dokumentieren von Anfang an. Wir haben in Berlin ein Evidenz-Lab, in dem auch Hacker beschäftigt sind und Videos sowie Bilder verifiziert werden. Das ist unsere Aufgabe in solchen Konflikten.
Aber was kann Amnesty International wirklich gegen Diktaturen oder Kriegsverbrechen ausrichten?
Wir haben verschiedene Druckmittel. Einerseits das Dokumentieren und Veröffentlichen von großen Berichten. Wir haben doch eine Glaubwürdigkeit für Medien und auch Ministerien fordern zum Teil Berichte über unsere Arbeit an. Andererseits haben wir zehn Millionen Mitglieder weltweit. Wenn wir unsere dringlichen Maßnahmen aufsetzen, um zum Beispiel politische Gefangene vor einer Hinrichtung zu bewahren, und dann viele Menschen anfangen, auf Knopfdruck Briefe und E-Mails zu schreiben, übt das schon Druck aus. Wir haben kürzlich eine afghanische Frauenrechtsaktivistin befreien können, weil wir Druck auf die Taliban-Behörden ausgeübt haben. Und zu guter Letzt bleibt uns noch der Lobbyismus hinter den Kulissen.
Wie kann man mit E-mails Druck auf die Taliban machen?
Grundsätzlich wird zuerst die uns zugetragene Geschichte verifiziert. Im Falle der afghanischen Frauenrechtlerin haben wir von London aus eine weltweite Aktion gestartet. Amnesty ist in 70 Staaten aktiv. Die nationalen Organisationen beginnen anschließend, die Botschaft an ihre Netzwerke zu verteilen. In Österreich sind das rund 70.000 Mitglieder, die regelmäßig spenden. Diese bekommen eine Mail zugesandt. Es reicht ein Klick in der E-Mail und es wird eine automatisierte E-Mail an die Taliban-Behörden ausgeschickt. Deren Postfach wird einfach gespamt, mit Nachrichten von Amnesty-Mitgliedern. Wir nehmen dann über das Büro in London Kontakt auf mit den de-facto Behörden. Wir arbeiten dabei eng mit der UNO zusammen. Viele Amnesty Mitarbeiter waren früher bei der UNO, da gibt es sehr viel Fluktuation. Das ist gar nicht so unähnlich, wie zum Beispiel Diplomaten das machen würden, aber vielleicht ein bisschen mutiger.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wird oft als westliche Errungenschaft angepriesen. Gibt es möglicherweise so etwas wie ein Problem der Akzeptanz der Menschenrechte in anderen Kulturen?
Sie sprechen da den Kulturrelativismus an. Den möchte ich nicht akzeptieren. Ich sehe die Menschenrechte als globales Leitprinzip und sie haben für alle zu gelten. Aber das Argument kommt immer wieder, interessanterweise oft von links. Das ist sehr schwierig für mich. Wenn wir damit anfangen, dann können wir niemals etwas allgemein Gültiges formulieren, wie zum Beispiel das Verbot der Folter oder das Verbot der Todesstrafe. Wir haben es im Groben zumindest geschafft, dass die Allgemeine Erklärung der UNO das globale Leitsystem ist. Es gibt auch Bestrebungen von Staatengruppen, eigene Menschenrechte zu formulieren und zu verabschieden. Und wir hören auch immer wieder von Politikern in der EU, die die Europäische Menschenrechtskonvention in Frage stellen, obwohl sie von allen Staaten unterzeichnet wurde. Auch in Österreich hört man Stimmen, die sagen: In der Form geht es eigentlich nicht.
Haben wir genug Menschenrechte?
Menschenrechte entwickeln sich laufend weiter, es gibt viele neue Themen. Das ist ein Manko der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das, was jetzt Thema ist, ist nicht darin niedergeschrieben. Beispielsweise wird die Klimagerechtigkeit immer mehr als Menschenrecht auch justiziell verankert. Es gab auch ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs dazu. Auch die Debatten rund um die geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung sowie die Digitalisierung sind neu in diesem Bereich, beziehungsweise die Frage: Wie gehen wir mit KI um? Wie wird die KI sich künftig auf den Gebrauch von Waffen auswirken und was hat das für einen Einfluss auf Kriegsverbrechen und die Verfolgung von diesen? Es gibt unglaublich viele Menschenrechte, die sich weiterentwickeln. Unser Zugang und auch jener der Vereinten Nationen ist, dass man neue Menschenrechtsdokumente schafft und diese dort integriert. Wenn man anstatt dessen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufmachen würde, würde dies niemals zu einem Konsens führen.
Was bedeutet Klimagerechtigkeit?
Vor zwei Jahren hat die UN-Generalversammlung erstmals in einer Resolution festgestellt, dass das Recht auf eine nachhaltige Umwelt ein Menschenrecht ist. Seit dieser Resolution laufen weltweit verschiedene Klimaklagen in verschiedenen Ländern, wie kürzlich in der Schweiz. Die Kläger möchten in einem Urteil festgestellt haben, dass ihr Recht, in einer gesunden Umwelt zu leben, tatsächlich ein Menschenrecht ist. Langsam sollen damit verbindliche Normen geschaffen werden, die dazu führen, dass Maßnahmen gesetzt werden, und Regierungen auch Maßnahmen setzen müssen, um eine gesunde Umwelt für künftige Generationen sicherzustellen. Es ist also kein Thema nur für Umwelt- oder soziale Organisationen mehr, sondern ist tatsächlich ein Menschenrechtsthema geworden. Wir achten dann darauf, dass Maßnahmen zum Klimaschutz menschenrechtskonform sind und keinesfalls diskriminierend.
Wie sieht es mit den Menschenrechten in Österreich aus?
Ein Problem, das noch nicht gelöst wurde, obwohl es im aktuellen Regierungsprogramm steht, ist die Obsorge für unbegleitete, geflüchtete Minderjährige. Jedes Jahr kommen tausende unbegleitete Minderjährige zwischen 14 und 18 Jahren nach Österreich und bekommen keine Betreuung. Das Zulassungsverfahren zum Asylverfahren dauert einige Monate. Bis dahin befinden sich die Jugendlichen in einem Schwebezustand und haben keine Möglichkeit, eine Ausbildung zu beginnen, haben keine Schulpflicht und werden auch sonst nicht betreut. Ein großer Teil dieser Jugendlichen verschwindet nach einigen Monaten aus den großen Flüchtlingslagern, weil sie sich selbst überlassen sind. Mit diesen Jugendlichen kann im Grunde alles passieren. In Österreich wird dann der Akt abgelegt. Das ist tatsächlich ein Problem.
Das vollständige Interview lesen Sie in der risControl Print Ausgabe – Mai.